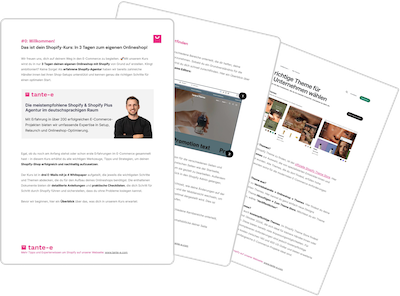Inventory Planning zählt zu den Themen, über die im E-Commerce selten gesprochen wird. Dabei ist einer der entscheidenden Faktoren, ob eine Marke langfristig profitabel wachsen kann. Denn: Die beste Marketing-Kampagne ist wertlos, wenn das Produkt am Ende nicht verfügbar ist.
Im tante-e-Podcast mit Johannes Gassner, Head of Growth bei fabrikatör, werfen wir einen praktischen Blick auf die Bedeutung von Inventory Planning für moderne E-Commerce-Brands. Die wichtigsten Erkenntnisse zum Inventory Planning für Shopify Händler:innen fassen wir in diesem Artikel zusammen.

Johannes bringt nicht nur die Erfahrung als ehemaliger Gründer eines eigenen DTC-Textilunternehmens mit, sondern begleitet mit fabrikatör heute eine Vielzahl an Marken in genau diesem Prozess: Von der strukturierten Datenbasis über Forecasting bis hin zu operativen Handlungsempfehlungen.
- Was ist Inventory Planning?
- Typische Fehler & Fallstricke - und wie man sie vermeidet
- Inventory Planning in der Praxis – wie Shopify Brands das Thema heute angehen
- Handlungsempfehlungen für strukturiertes Inventory Planning
- Inventory Planning Tools für Shopify: Wann Excel reicht – und wann nicht mehr
- Fazit: Die wichtigsten Learnings im Überblick
1. Was ist Inventory Planning – und warum ist es so entscheidend?
Inventory Planning ist mehr als nur die Entscheidung, welche Produkte wann bestellt werden. Es ist die Verbindung von Marketing, Finanzen und Einkauf – und damit ein zentrales Steuerungsinstrument für profitables Wachstum im E-Commerce.
Johannes beschreibt Inventory Planning als den Abgleich zwischen dem, was ein Unternehmen verkaufen möchte (Demand), und dem, was es tatsächlich liefern kann (Supply). Ziel ist es, mit begrenztem Kapital möglichst viel Wirkung zu erzielen – ohne Überbestände sowie Out-of-Stock-Situationen.
Inventory Planning umfasst im Kern drei Ebenen:
| Ebene | Fokus | Ziel |
|---|---|---|
| Demand Planning | Marketingplanung, erwartete Nachfrage, externe Faktoren | Was wollen wir verkaufen – und was ist realistisch? |
| Supply Planning | Lagerbestand, Lieferanten, Produktionskapazitäten, Lead Times | Was können wir liefern – und zu welchen Bedingungen? |
| Abgleich & Steuerung | Finanzielle Mittel, Zeitpunkte, saisonale Faktoren | Was ist machbar – ohne Liquidität zu verlieren? |
Ein typisches Beispiel aus dem Alltag: Eine Marke plant eine Kampagne für Januar. Sie rechnet mit hoher Nachfrage, weil der Januar erfahrungsgemäß ein starker Verkaufsmonat ist, z.B. für Sport- oder Wellnessprodukte. Wird in diesem Moment zu wenig Ware vorgeplant, droht Out-of-Stock. Wird zu viel Ware eingekauft, fehlt im schlimmsten Fall das Budget für die Kampagne selbst.
Die zentrale Herausforderung:
Im E-Commerce ist Kapitalbindung durch Lagerbestände ein relevanter Faktor. Wer zu viel einkauft, blockiert Liquidität – wer zu wenig einkauft, verliert Umsatz. Besonders problematisch wird das, wenn der Forecast nicht auf soliden Daten basiert.
Joahnnes bringt es auf den Punkt: „Du zahlst 50 Euro dafür, dass jemand in deinen Shop kommt – und dann kann die Person nicht kaufen, weil du nichts auf Lager hast. Das ist das Bitterste, was dir passieren kann.“
Inventory Planning ist daher kein operatives Detail, sondern ein strategischer Hebel. Marken, die diese Disziplin früh ernst nehmen, schaffen sich einen entscheidenden Vorteil.
2. Typische Fehler und Fallstricke – und wie man sie vermeidet
Trotz der zentralen Bedeutung wird Inventory Planning in vielen E-Commerce-Unternehmen stiefmütterlich behandelt – oft mit schwerwiegenden Folgen. Johannes spricht im Podcast offen über wiederkehrende Muster, die er in der Zusammenarbeit mit über 200 Marken beobachtet hat. Die häufigsten Fehler im Überblick:
2.1. Planung nach Bauchgefühl statt auf Datenbasis
Viele Unternehmen bestellen Produkte „wie es sich richtig anfühlt“ – ohne konkrete Analysen oder Forecasting. Das funktioniert so lange, bis die erste Wachstumsphase vorbei ist oder externe Faktoren die Nachfrage beeinflussen.
2.2. Out-of-Stock wird hingenommen
Eine Out-of-Stock-Rate von 30–40 % sei in manchen Unternehmen „business as usual“. Das Problem: Die Marke verliert nicht nur Umsatz, sondern auch Kundenvertrauen – und verschwendet gleichzeitig Marketingbudget.
2.3. Kapitalbindung durch Überbestände
Wer zu viel auf Lager legt, bindet Liquidität, die an anderer Stelle – etwa im Marketing oder in der Produktentwicklung – fehlt. Besonders gefährlich wird das bei saisonalen Produkten oder Modeartikeln, deren Relevanz schnell verfallen kann.
2.4. Keine differenzierte Analyse der Lagerdaten
Ohne Aufschlüsselung nach Kategorien, Verkaufskanälen oder Zeiträumen fehlt das Verständnis, welche Produkte wirklich wichtig sind. Johannes nennt hier die ABC-Analyse als zentrale Methode:
| Kategorie | Anteil am Umsatz | Handlungsempfehlung |
|---|---|---|
| A-Produkte | ~80 % | Immer verfügbar halten – höchste Priorität |
| B-Produkte | ~15 % | Nach Bedarf bevorraten, Upsell nutzen |
| C-Produkte | ~5 % | Lager abbauen, Sortiment überdenken |
2.5. Vernachlässigung der Turnover Rate und Cash Cycles
Ein Produkt, das drei Monate im Lager liegt, blockiert Kapital – selbst wenn es sich letztlich verkauft. Besser sind Produkte mit hohem Lagerumschlag: Sie drehen sich schneller und generieren mehr Gewinn in kürzerer Zeit.
Was stattdessen hilft:
- Monitoring & Tracking als Pflichtaufgabe etablieren
- Saisonalität systematisch auswerten (z. B. mit mehrjährigen Verkaufsdaten)
- Zielgerichtete Kommunikation mit Lieferanten, um Puffer oder Vorproduktion zu ermöglichen
- Konsequente KPI-Auswertung mit Fokus auf Margen, Nachfrageverteilung und Verfügbarkeit
3. Inventory Planning in der Praxis – wie Shopify Brands das Thema heute angehen
Wie sieht Inventory Planning konkret im Alltag von E-Commerce-Brands aus? Im Gespräch teilt Johannes Gassner Einblicke in die Zusammenarbeit von fabrikatör mit Marken, die heute systematisch an ihrer Bestandsplanung arbeiten.
3.1. Der erste Schritt: Ehrliche Bestandsaufnahme
Oft beginnt der Prozess mit einer einfachen Frage: „Wie macht ihr das aktuell?“ Denn ganz ohne Planung geht es nie – irgendjemand trifft immer Entscheidungen. Ob bewusst oder unbewusst, ob datenbasiert oder aus dem Bauch heraus. Johannes betont:
„Selbst wenn nach Gefühl bestellt wird – das ist auch schon ein System. Nur eben ein sehr fehleranfälliges.“
Danach folgen drei zentrale Schritte:
3.2.. Datenstruktur schaffen
Verkaufsdaten, Retouren, Lieferzeiten, Lieferanteninformationen, Forecasts aus dem Marketing: All diese Daten liegen oft verteilt in verschiedenen Tools und Formaten vor. Ziel ist es, sie in einer einheitlichen Struktur zusammenzuführen. Nur so lassen sich verlässliche Analysen und Entscheidungen treffen.
3.3.. Einflussfaktoren identifizieren
Welche Faktoren treiben die Nachfrage? Saisonalität, Wetter, Marketingkampagnen, Influencer-Spikes – all das beeinflusst, wie viele Produkte benötigt werden. Johannes beschreibt es als eine Art „Tapete“, auf der man verschiedene Datenquellen zusammenführt, bewertet und daraus Forecasts ableitet.
3.4. Forecasts testen und iterativ verbessern
Kein Forecast ist perfekt. Der Schlüssel liegt darin, Annahmen systematisch zu dokumentieren, die Realität dagegenzuhalten und daraus zu lernen. Warum lagen wir daneben? Was wurde übersehen? Wo fehlt noch ein Datenpunkt? So entsteht Schritt für Schritt ein belastbares Modell.
Beispiel aus der Praxis: Eine finnische Schuhmarke
Eine Marke mit mehreren Verkaufskanälen – Online-Shop und stationäre Stores – hatte über das gesamte Jahr hinweg mit Out-of-Stock-Problemen zu kämpfen. Die Folge: interner Streit über Bestellmengen, verpasster Umsatz, unklare Verantwortlichkeiten.
Fabrikatör begleitete die Marke mit folgenden Maßnahmen:
- Konsolidierung der Daten aus allen Kanälen
- Aufbau einer einheitlichen Datenbank
- Durchführung von ABC- und XYZ-Analysen zur Priorisierung der Produkte
- Identifikation saisonaler Muster, z. B. bei bestimmten Farben oder Modellen
- Einführung von Backorder-Funktionalitäten zur Reduktion von Lost Revenue
Das Ergebnis:
- Out-of-Stock-Rate wurde in wenigen Monaten um 50 % gesenkt
- Umsatzverluste durch Vorbestellungen (Backorders) deutlich reduziert
- Klarheit im Team über Prioritäten und Bestellentscheidungen geschaffen
Inventory Planning wird so vom Reaktionsmodus in den Gestaltungsmodus überführt und ermöglicht es Marken, gezielt zu steuern statt zu improvisieren. Besonders bei wachsendem Sortiment und mehreren Verkaufskanälen ist dieser Übergang entscheidend.
4. Handlungsempfehlungen: So gehst du Inventory Planning strukturiert an
Die Theorie ist nachvollziehbar – doch wie setzt man Inventory Planning konkret um? Johannes teilt eine klare Vorgehensweise, die sich für viele Marken bewährt hat. Der Schlüssel: strukturierter Aufbau, pragmatisches Vorgehen und kontinuierliche Verbesserung.
Vier Schritte für den Einstieg ins Inventory Planning:
1. Status Quo erfassen
- Welche Systeme nutzt ihr aktuell? (ERP, Shopify, Excel, etc.)
- Wie werden Bestellungen heute geplant und durchgeführt?
- Welche Pain Points im Lager oder der Supply Chain sind bekannt?
Ziel: Transparenz schaffen über Prozesse, Zuständigkeiten und Schwachstellen.
2. Datenquellen identifizieren und vereinheitlichen
Relevante Datenquellen:
- Sales Channels (z. B. Shopify, Amazon, POS)
- Retouren- und Lagerdaten
- Lieferzeiten und Produktionskapazitäten
- Marketingpläne und geplante Aktionen
Wichtig: Alle Daten in ein einheitliches Format bringen, um sie vergleichen und analysieren zu können.
3. Forecasting-Modell aufbauen
Einflussfaktoren identifizieren:
- Saisonale Muster
- Wetter, Events, externe Faktoren
- Marketingmaßnahmen (Performance, Influencer, Drops)
Forecasts als Hypothese behandeln, dokumentieren und mit realen Daten abgleichen. Erkenntnisse in Folgezyklen übertragen – Forecasting wird mit jeder Iteration besser.
4. Datenbasiert handeln & kontinuierlich optimieren
- Regelmäßige Reviews: Was ist gut gelaufen? Wo lagen wir daneben?
- Zusammenarbeit zwischen Einkauf, Marketing und Finance stärken
- Analysen gezielt einsetzen: z. B. ABC-Analyse für Priorisierung, Turnover Ratio zur Kapitalbindung
5. Zusätzlicher Hebel: Backorders einführen
Backorders – also die Möglichkeit, ausverkaufte Produkte vorbestellen zu können – helfen nicht nur, Lost Revenue zu reduzieren, sondern auch die Liquidität zu verbessern. In vielen Fällen konnten laut Experte damit 50–70 % des potenziellen Umsatzverlusts aufgefangen werden – ohne zusätzliche Werbekosten.
Was dabei wichtig ist:
- Erwartungshaltung klar kommunizieren (Lieferzeiten, Status-Updates)
- Prozesse automatisieren (z. B. via Shopify und Klaviyo)
- Kundenerlebnis priorisieren (z. B. durch Echtzeitinformationen und proaktive Kommunikation)
Inventory Planning ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess.
Wer ihn konsequent aufsetzt, schafft die Grundlage für verlässliche Entscheidungen, effizienten Kapitaleinsatz – und am Ende: mehr Umsatz mit weniger Risiko.
5. Inventory Planning Tools für Shopify: Wann Excel reicht – und wann nicht mehr
Viele Shopify Brands starten ihr Inventory Planning mit Excel – und das ist vollkommen legitim. Laut Johannes gibt es Unternehmen, die mit siebenstelligen Umsätzen noch immer über manuelle Tabellen planen. Was dabei oft unterschätzt wird: Der Aufwand steigt mit der Komplexität. Mehr Produkte, mehr Channels, mehr Lieferanten – und plötzlich verbringen Teams Tage oder gar Wochen damit, Forecasts zu aktualisieren.
Die Grenzen von Excel:
- Fehleranfälligkeit durch manuelle Eingaben
- Keine automatische Datenintegration aus Systemen wie Shopify, ERP oder Marktplätzen
- Keine Historie, keine Szenarien, keine automatisierten Alerts
- Schwierige Zusammenarbeit bei mehreren Beteiligten (z. B. Marketing, Finance, Operations)
Ein modernes Tool wie fabrikatör setzt genau hier an:
| Funktion | Vorteil für Inventory Planning |
|---|---|
| Automatische Datenanbindung | Verknüpfung mit Shopify, Marktplätzen & ERP – keine manuellen Exporte nötig |
| Über 150 KPIs & Analysen | Direkte Einblicke in Out-of-Stock-Raten, Turnover, Forecast-Abweichungen etc. |
| Backorder-Funktionalität | Produkte trotz Out-of-Stock weiter verkaufen, inkl. automatisierter Kommunikation |
| Klaviyo-Integration | Zielgerichtete Updates bei Verzögerungen oder Änderungen im Lieferstatus |
| Forecasting mit Experten | „Inventory Analyst on Demand“ – individuelle Betreuung ohne eigenes Inhouse-Team |
Die Erkenntnis:
Je mehr Vertriebskanäle und Produkte eine Marke hat, desto dringender braucht es ein System, das Komplexität reduziert – nicht verstärkt. Tools helfen Shopify-Händler:innen dabei, den Überblick zu behalten, datenbasiert zu entscheiden und schneller zu handeln. Und genau das macht am Ende den Unterschied.
6. Fazit: Die wichtigsten Learnings zum Inventory Planning
6.1. Planung ist Teamarbeit
Inventory betrifft nicht nur das Lager oder den Einkauf. Es braucht das Zusammenspiel von Marketing, Finance und Operations – auf einer gemeinsamen Datengrundlage.
6.2. Ohne saubere Daten kein verlässlicher Forecast
Egal ob Excel oder spezialisiertes Tool: Wer nicht weiß, wie sich Produkte entwickeln, kann nicht gezielt steuern. Analysen wie ABC-/XYZ-Klassifizierungen, Turnover-Ratios oder Lost-Revenue-Prognosen liefern die notwendige Grundlage.
6.3. Komplexität nimmt mit Wachstum zu
Mehr Produkte, mehr Kanäle, mehr Märkte – was am Anfang mit Gefühl und Tabellen funktioniert, braucht irgendwann klare Prozesse, strukturierte Daten und unterstützende Tools.
6.4. Backorders sind ein einfacher, wirkungsvoller Hebel
Sie reduzieren verlorene Umsätze, verbessern die Planbarkeit für Lieferanten und helfen, Liquidität zu sichern – vorausgesetzt, Kommunikation und Erwartungsmanagement sind sauber aufgesetzt.
6.5. Denn Inventory Planning ist kein rein operatives Thema, sondern ein wichtiger strategischer Faktor. Wer heute gezielt in Datenstruktur, Forecasting und Systematisierung investiert, schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, zufriedenere Kund:innen und bessere Margen.